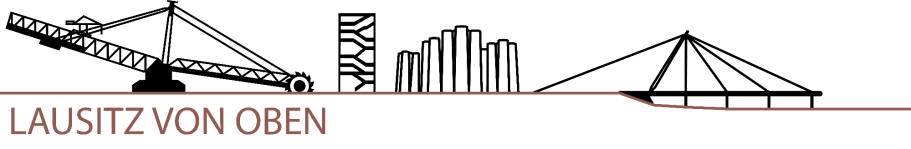BIOTÜRME LAUCHHAMMER
EIN RELIKT DER INDUSTRIEGESCHICHTE
Lauchhammer ist eine kleine Stadt im Süden Brandenburgs und gehört zum Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Wie der Rest der Lausitz ist auch Lauchhammer stark von der industriellen Geschichte geprägt, was man am Ortsrand auf dem ehemaligen Industriegelände der alten Kokerei durch 24 verbliebene Biotürme erleben kann.

GESCHICHTE
Nach der Teilung Deutschlands gab es im Territorium der DDR keine nennenswerte Steinkohlelagerstätten oder ausreichend Kokereikapazitäten. Eine der bedeutendsten Aufgaben des 5-Jahresplans der DDR war also der Aufbau der weltweit ersten Großkokerei, die aus Braunkohle BHT-Koks (hüttenfähigen Hochtemperaturkoks) herstellen sollte.
Baubeginn war der 01.10.1951 und bereits am 14.06.1952 wurde der erste Koks abgezogen, eine auch schon für damaligen Bedingungen einmalige Baustelle. Der Standort Lauchhammer wurde aufgrund der für die Verkokung geeigneten asche- und schwefelarmen Braunkohlelagerstätten in Kleinleipisch und Klettwitz ausgewählt.
Durch die Kokerei Lauchhammer fanden nicht nur etwa 12.000 Bewohner eine Beschäftigung, sondern der damit verbundene wirtschaftliche Aufschwung sorgte auch dafür, dass das Leben der ehemaligen Dörfer des Mückenberger Ländchens, die seit 1953 die Stadt Lauchhammer bildeten, gesellschaftlich enorm geprägt wurden.
Die Kokerei schloss am 30.10.1991.

TECHNISCHE ECKDATEN
Die Großkokerei umfasste 24 Ofeneinheiten verteilt auf 2 Ofenstraßen. Die Brikettzufuhr erfolgte durch kilometerlange Bandstraßen zu den umliegenden Brikettfabriken in Lauchhammer und prägten dadurch auch das Stadtbild.
Beim Verkokungsprozess wurden den Feinstkornbriketts bei circa 1000°C Wasser und Rohgas entzogen. Durch die 16 Kokskühler wurde der Koks für die Lagerung gekühlt und nach Größe sortiert. Durch die Verkokung entsteht sogenanntes Prozesswasser, welches einen Phenolgehalt von
20 g/l vorweist. Phenol ist ein Gefahrstoff (giftig und entzieht dem Wasser Sauerstoff). Durch das Turmtropfkörper-Verfahren wird dieses aus dem Wasser herausgefiltert. Die Großkokerei Lauchhammer war mit ihrer seit 1958/1959 eingesetzten Großanlage zur Reinigung von Phenoldünnwasser, die Erste in Europa und war ein unglaublich wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung der Biotechnik.

TURMTROPFKÖRPER-VERFAHREN
Das Abwasser rieselt bei diesem Verfahren durch einen aus losen Schlackensteinen bestehenden Körper, welcher in einer schornsteinartigen Ummauerung eingebaut ist: die Biotürme. Durch die entstehende Sogwirkung des oben und unten offenen Schornsteins (Kamineffekt) kommt es zu einer Wechselwirkung zwischen Wasser und Luft. Durch die Zuführung von Luftsauerstoff bilden sich Mikroorganismen (Bakterien, einzelne Lebewesen, Protozoen, Algen, Flagellaten, Älchen), die organische Säuren oder Phenole abbauen. Der Zusatz von Phosphorsäure war für die Erhaltung und Vermehrung der Mikroorganismen zwingend notwendig. Das „vorgereinigte“ Wasser wird nun im Belebtschlammbecken mit Frischschlamm geimpft, der den Abbau organischer Verunreinigungen beschleunigt. Im Nachklärbecken wird der Belebtschlamm wieder abgesetzt.
Beim Reinigungsprozess fallen neben Schlamm aber auch Schwefelwasserstoff und organische Schwefelverbindungen an, die einen unangenehmen Geruch in der Umgebung verursachen.

CHARAKTERISTIKA EINES TURMS
Höhe: 22,00 m
Durchmesser: 3,50 m
Volumen: 200 m³
Turminhalt: 200 m³
Schlackengestein, Körnung 30-200mm
Abwasserdurchsatz: 240 m³/h
PRODUKTIONSERGEBNISSE
BHT-Koks: 3.100 t/Tag
Teer: 210 t/Tag
Leichtöl: 130 t/Tag
Phenol: 20 t/Tag
Stadtgas: 1.800 Tm³/Tag
ARBEITNEHMER DER KOKEREI
Kokereibetrieb: 1.200 Arbeitnehmer
Anschlussbahn: 100 Arbeitnehmer
Bauabteilung: 75 Arbeitnehmer
Instandhaltung: 450 Arbeitnehmer
Energieversorgung: 25 Arbeitnehmer
Betriebsfeuerwehr: 30 Arbeitnehmer
Sanitätsstelle: 10 Arbeitnehmer
Gasschutzstelle: 5 Arbeitnehmer
Fremdbetriebe: 100 Arbeitnehmer
Gesamt circa.: 1.800 – 2000 Arbeitnehmer
BIOTÜRME LAUCHHAMMER HEUTE
Heute ist von dem über 120 Hektar großen Industriegelände nicht mehr viel zu sehen. Als einziges Überbleibsel ragen nur noch die 24 Biotürme als letztes Relikt hervor. Die IBA erkannte schnell ein großes Potenzial für eine kulturelle Umnutzung. Viele lange Diskussionen mit der Denkmalschutzbehörde standen bevor, um den Abriss der Biotürme zu verhindern. Durch den unerwarteten Erfolg des nahen Besucherbergwerks F60 fand sich im Jahre 2003 mit dem Kunstgussmuseum Lauchhammer dann ein neuer Träger und 2005 begannen die Sanierungsarbeiten. Die Sanierung dauerte knapp 2 Jahre und einer der Türme wurde mit, nach dem Entwurf des Cottbuser Büros Jähne & Göpfert sowie Zimmermann & Partner, zwei gläsernen Aussichtskanzeln ausgestattet. Die im Nachhinein gegossenen Betonkreuze im geometrischen Raster zeigen nochmal, dass die Biotürme einmal Teil einer viel größeren Anlage waren. Durch Infotafeln auf dem Gelände werden dem Besucher die Prozesse der Koksbearbeitung und Dünnwasserreinigung erklärt.
2008 konnten die Biotürme als begehbares Industriedenkmal und Veranstaltungsort eröffnet und besucht werden. Seitdem finden hier regelmäßig Veranstaltungen und Begehungen statt.
2009 gewannen die Biotürme sowohl den Brandenburgischen Ingenieurpreis als auch den Denkmalpreis des Landes.
Bei unserer Exkursion im Oktober 2024 war die Anlage der Biotürme aus technischen Gründen bis auf Weiteres geschlossen.
IMPRESSIONEN
STANDORT
WEITERE INFOMARTIONEN
Weitere Informationen zu den Biotürmen Lauchhammer und den touristischen Angeboten finden Sie unter folgenden Websites:
© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.