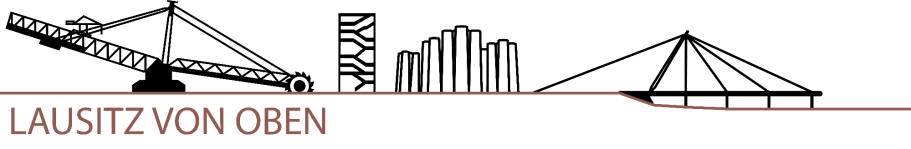DIE BRAUNKOHLE
© DianaH / Adobe Stock
BESCHREIBUNG UND ENSTEHUNG
Braunkohle ist ein fossiler Energieträger und ein brennbares Sedimentgestein, das aus organischen Materialien wie abgestorbenen Pflanzenresten besteht, die über Millionen von Jahren unter bestimmten geologischen Bedingungen verdichtet wurden.
Braunkohle ist ein Zwischenstadium in der Entwicklung von Torf zu Steinkohle und enthält im Vergleich zu Steinkohle weniger Kohlenstoff und mehr Wasser, was sie energetisch weniger effizient macht und den Transport erschwert.
Der Entstehungsprozess begann vor etwa 30 bis 70 Millionen Jahren, vor allem im Tertiär, als dichte Wälder und sumpfige Gebiete große Mengen organischer Substanz hervorbrachten. Diese Pflanzenreste, darunter Bäume, Farne und Moose, sammelten sich in Mooren und Sümpfen an, wo sie unter Sauerstoffmangel nur unvollständig zersetzt wurden.
Dadurch bildete sich eine dicke Schicht aus Torf, die die Grundlage für die spätere Braunkohle darstellte.
Im Laufe der Zeit wurden diese Torfschichten von Sedimenten wie Sand, Ton und Schluff überlagert. Der Druck, den die darüber liegenden Schichten ausübten und die anhaltende geologische Aktivität führten dazu, dass die organischen Materialien komprimiert wurden. Durch die steigende Temperatur und den Druck wurden die Wasseranteile sowie flüchtige Bestandteile teilweise aus dem Torf entfernt, während sich der Kohlenstoffanteil erhöhte. Dieser Prozess der Inkohlung, der mehrere Millionen Jahre in Anspruch nimmt, wandelte den Torf zuerst in Braunkohle und später, unter noch höheren Druck- und Temperaturbedingungen, in Steinkohle um.
Braunkohle weist einen relativ hohen Wassergehalt und einen geringeren Kohlenstoffanteil im Vergleich zur Steinkohle auf. Diese Eigenschaften machen sie weniger energiedicht, aber leichter zugänglich, da sie oft in relativ flachen Erdschichten vorkommt und im Tagebau gefördert werden kann. Die Entstehung von Braunkohle spiegelt somit eine frühe Phase in der Umwandlung organischer Substanz wider und macht sie zu einem wichtigen, aber umstrittenen Energieträger in der heutigen Zeit.

© Lubos Chlubny / Adobe Stock
VORKOMMEN IN DER LAUSITZ
Die Lausitz, eine Region in Brandenburg und Sachsen, ist eines der wichtigsten Braunkohlereviere in Deutschland. Die Braunkohle liegt vor allem in den flachen Sedimentbecken. Hier werden die Kohlevorkommen im Tagebau abgebaut, wobei die Kohleflöze relativ nah an der Erdoberfläche liegen.
In der Lausitz gibt es mehrere aktive und ehemalige Tagebaue. Einige der bedeutendsten Abbaugebiete sind: Tagebau Jänschwalde, Tagebau Welzow-Süd, Tagebau Nochten, Tagebau Reichwalde und Tagebau Cottbus-Nord. Die Lausitz verfügt dementsprechend über mehrere Milliarden Tonnen an Braunkohle. Der Kohlegehalt kann unterschiedlich sein, ist aber typischerweise für die Energiegewinnung geeignet. Die Kohlevorkommen stellen eine bedeutende Energiequelle für die Lausitzer Region und auch für Deutschland dar.
FÖRDERMETHODEN
Die Braunkohle wird aufgrund der nahen Lage an der Erdoberfläche vor allem im Tagebau gefördert. Der Tagebau bietet hier auch die wirtschaftlichste Methode der Braunkohleförderung, wobei die oberflächennahen Kohleschichten freigelegt werden und dann abgetragen werden. Weitere Fördermethoden sind der Untertagebau (selten bei Braunkohle), die Hydraulische Förderung, bei dieser die Braunkohle mit Hochdruckwasserstrahlen gelöst und in Schlämme zur Aufbereitung transportiert werden (experimentelle Versuche in einzelnen Ländern) und die In-situ-Gasifizierung. Hierbei werden die Kohlevorkommen vor Ort in ein gasförmiges Produkt umgewandelt (bisher nur in Pilotprojekten erprobt).

© LianeM / Adobe Stock
UMSIEDLUNGEN
Die Umsiedlungen in der Lausitz für den Braunkohletagebau sind ein komplexer und oft emotionaler Prozess, der seit dem Beginn des großflächigen Kohleabbaus durchgeführt wird. Zahlreiche Dörfer und Städte wurden teilweise oder vollständig abgerissen, um Platz für den Tagebau zu schaffen. Die Durchführung solcher Umsiedlungen hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, ist jedoch stets mit erheblichen sozialen, kulturellen und ökologischen Herausforderungen verbunden.
Seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert begann der großflächige Braunkohleabbau und damit auch die ersten Umsiedlungen von Siedlungen in der Lausitz. Besonders in der DDR-Zeit (1949–1990) wurden zahlreiche Dörfer für den Braunkohletagebau abgebaggert. Der Fokus lag auf der Versorgung der Energieindustrie, häufig ohne umfassende Mitsprachemöglichkeiten der Bevölkerung. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 gab es zwar verstärkte Proteste und Mitspracherechte, doch der Abbau und die damit verbundenen Umsiedlungen wurden in einigen Gebieten fortgeführt.
Umsiedlungen wurden anfangs durch Raumordnungs- und Genehmigungsverfahren in die Wege geleitet, daraufhin wurden die Betroffenen informiert und mit ihnen individuell Entschädigungen in Entschädigungsverhandlungen vereinbart. Neue Ortschaften wurden an Ersatzorten geschaffen, um soziale Strukturen zu erhalten. Religiöse und kulturelle Denkmäler wie Kirchen wurden oft an neuen Orten rekonstruiert. Nachdem die Bürgerschaft das Dorf verlassen hatte, wurde es abgetragen und die Landschaft war für den Abtrag der Erdschichten vorbereitet. Ein Beispiel für diese Umsiedlung aus der Lausitz ist die Ortschaft Horno, welche als Neu-Horno umgesiedelt wurde, auch wenn der Protest der Bürger groß gewesen war.
AUSWIRKUNGEN AUF DAS GRUNDWASSER
Der Braunkohleabbau, insbesondere im Tagebau, hat erhebliche Auswirkungen auf das Grundwasser. Um Braunkohle im Tagebau fördern zu können, müssen die Kohleflöze trocken gelegt werden, da sie oft unterhalb des natürlichen Grundwasserspiegels liegen. Dies geschieht durch das Abpumpen von Grundwasser, was zu einer großräumigen Absenkung des Grundwasserspiegels führt. Die Folgen sind ausgetrocknete Böden, Flüsse und generell Wasserquellen. Auch in der umgebenden Landwirtschaft bleibt der Braunkohleabbau nicht unbemerkt, hier sinkt durch das fehlende Wasser die Bodenqualität und die Ernteerträge. Auch Wälder und Feuchtgebiete können durch den Wassermangel absterben. Durch das fehlende Grundwasser entstehen in der Tiefe neue Grundwasserströme und Anlagerungen, was auch zu Salz- und Schadstoffeinträgen führen kann. Dementsprechend kann die Sulfatkonzentration ansteigen und das versauerte Wasser kann daraufhin auch in Seen und Flüsse gelangen. So wird die Tier- und Pflanzenwelt in dieser Region stark negativ beeinflusst. Das Ganze sorgt für erhöhte Kosten in der Grundwasserversorgung, da neue Brunnen angelegt werden müssen und enorme Mengen an Wasser aufwendig gereinigt werden müssen. In der Lausitz gibt es beispielsweise eine erhöhte Belastung in der Spree und auch in der Cottbuser Ostsee.

© AnnaReinert / Adobe Stock
AUSWIRKUNGEN AUF DIE LANDSCHAFT
Der Braunkohleabbau, insbesondere im Tagebau, führt zu tiefgreifenden Veränderungen in der Landschaft. Die Eingriffe betreffen großflächige Gebiete und hinterlassen oft nachhaltige Spuren, die sowohl die Natur als auch die menschliche Nutzung der Landschaft beeinflussen. Der Abbau beginnt mit dem Entfernen von Deckschichten wie Mutterboden, Sand, Kies und Gestein, wodurch die natürliche Vegetation und Tierwelt vollständig zerstört werden. Landwirtschaftliche Flächen, Wälder und Dörfer müssen oft weichen, was die traditionelle Nutzung und das kulturelle Erbe beeinträchtigt. Die Tagebaue hinterlassen riesige Löcher in der Landschaft, die oft hunderte Meter tief und viele Quadratkilometer groß sind. Das abgebaute Material aus den Deckschichten wird auf künstlichen Halden abgelagert, die neue Landschaftsformen wie Hügel oder Plateaus schaffen. Der Grundwasserspiegel verändert sich durch ständiges Trockenlegen der Abbaufläche, weshalb auch Flüsse und Bäche umgeleitet werden müssen. Nach Beendigung des Braunkohleabbaus werden viele Gebiete rekultiviert, um die Nutzung der Flächen wiederherzustellen. Dies führt zu neuen Landschaftstypen. Viele ehemalige Tagebaue werden geflutet und in Seen umgewandelt, wodurch Seenlandschaften wie der Partwitzer See, der Geierswalder See und die Cottbuser Ostsee entstehen. Diese Seen sind oft Teil des Tourismuskonzepts, bieten aber auch neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Auf Rekultivierungsflächen werden Wälder angelegt oder Böden wieder für die Landwirtschaft nutzbar gemacht. Oft bleibt die Bodenqualität jedoch eingeschränkt. Einige rekultivierte Flächen werden als Rückzugsgebiete für seltene Tier- und Pflanzenarten genutzt und dann oft zu Naturschutzgebieten ernannt. Rekultivierte Landschaften wirken oft künstlich und unterscheiden sich deutlich von der ursprünglichen, natürlichen Topografie. Während des Tagebaus ist die Landschaft durch seine Infrastruktur, wie Förderbänder, Schaufelradbagger und Kraftwerke, dominiert. Während des Abbaus ist auch der Verlust von Lebensräumen sowie Bodenschädigungen gängig, welche die Fruchtbarkeit tiefgreifend verändert. Meist sind rekultivierte Landschaften anfällig für das Eindringen von invasive Pflanzen- und Tierarten. Nachhaltige Renaturierungsmaßnahmen können die ökologischen und ästhetischen Folgen mildern, die ursprüngliche Landschaft jedoch nicht vollständig wiederherstellen.

© H&C / Adobe Stock
© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.