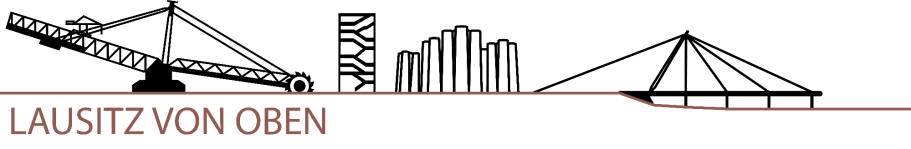DIE LAUSITZ
© H&C/ Adobe Stock
LAGE UND GEOGRAPHIE
Die Lausitz ist eine Region in Deutschland und Polen. Der Name ist abgeleitet vom sorbischen łuža, was in etwa „sumpfige, feuchte Wiesen“ bedeutet. Sie umfasst den Süden Brandenburgs und den Osten des Freistaates Sachsen sowie Teile der polnischen Woiwodschaften Niederschlesien und Lebus. Die Lausitz gliedert sich von Nord nach Süd in Niederlausitz, Oberlausitz und Lausitzer Gebirge. Heute bildet der Spreewald den nördlichsten Teil der Niederlausitz; ursprünglich reichte sie bis zum Berliner Müggelsee. Vom Lausitzer Gebirge gehört nur der deutsche Teil, der als Zittauer Gebirge bekannt ist, zur Lausitz, nicht aber der tschechische Teil. Heute bildet die Lausitzer Neiße zwischen dem deutschen und polnischen Teil der Lausitz die Grenze.
Der Landkreis Görlitz sowie der größte Teil des Landkreises Bautzen zählen in Sachsen zur Oberlausitz. Zur brandenburgischen Niederlausitz gehören der Süden des Landkreises Oberspreewald-Lausitz (außer zwei Gemeinden im äußersten Südwesten) und der Landkreis Spree-Neiße, Teile der Landkreise Elbe-Elster, Dahme-Spreewald und Oder-Spree sowie die kreisfreie Stadt Cottbus. In Polen zählen die Landkreise Zgorzelec und Lubań in der Woiwodschaft Niederschlesien zur Oberlausitz und Teile der Landkreise Zagań und Krosno in der Woiwodschaft Lebus zur Niederlausitz.
GESCHICHTE
Der Landkreis Görlitz sowie der größte Teil des Landkreises Bautzen zählen in Sachsen zur Oberlausitz. Zur brandenburgischen Niederlausitz gehören der Süden des Landkreises Oberspreewald-Lausitz (außer zwei Gemeinden im äußersten Südwesten) und der Landkreis Spree-Neiße, Teile der Landkreise Elbe-Elster, Dahme-Spreewald und Oder-Spree sowie die kreisfreie Stadt Cottbus. In Polen zählen die Landkreise Zgorzelec und Lubań in der Woiwodschaft Niederschlesien zur Oberlausitz und Teile der Landkreise Zagań und Krosno in der Woiwodschaft Lebus zur Niederlausitz.
Besiedlung Niederlausitz
Die Lausitzer Kultur, benannt nach frühen archäologischen Funden in der Niederlausitz, war eine Kulturgruppe der mittleren und späten Bronzezeit (ca. 1200 v. Chr.), die weite Teile Ostdeutschlands, Polens und Ungarns umfasste. Sie gehörte zu den Urnenfelderkulturen, die für ihre Bestattung Verstorbener in Urnengräbern bekannt waren.
Vor der Völkerwanderung besiedelten germanische Stämme die Lausitz und assimilierten die ansässigen Kelten. Während der Völkerwanderung zogen viele Germanen ab oder wurden in die slawische Bevölkerung integriert. Ab dem 6. Jahrhundert n. Chr. war die Niederlausitz von slawischen Stämmen besiedelt, die aus dem Warthe-Weichsel-Gebiet und den nördlichen Karpaten stammten. Der fränkische Chronist Fredegar erwähnte 631 die „Surbi“, die Vorfahren der heutigen Sorben. Im Zentrum siedelte der Stamm der „Lusizi“, der dem späteren Markgrafentum Niederlausitz seinen Namen gab.
Die Hauptsiedlungsform war das Dorf, das aus unregelmäßig angeordneten Gehöften bestand. Ab dem 7. Jahrhundert wurden Burgwälle typisch für die sorbische Siedlung, zunächst als Zufluchtsorte bei feindlichen Angriffen, später als Zentrum von Dorfgemeinschaften. Diese Gemeinschaften ersetzten die großfamilienbasierten Strukturen und bildeten mehrere Dörfer zu einem Burgbezirk zusammen, der von einem Burgherrn (*župan*) und seinen Kriegern kontrolliert wurde.
Besiedlung und territoriale Konsolidierung
Im späten 8. Jahrhundert begann das Frankenreich mit der Expansion, die 919 mit der Konsolidierung des ostfränkischen Reiches ihren Höhepunkt erreichte. Ziel war die Unterwerfung der slawischen Stämme, und 932 wurden die „Lusizer“ von Heinrich I. besiegt. Dies führte zur Christianisierung der eroberten Gebiete.
Im 12. Jahrhundert wurde die Mark Lausitz als königliches Lehen unter den wettinischen Markgrafen gegründet. In dieser Zeit bildeten sich größere Grundherrschaften, und das Land wurde an Adelige, Ritter, Bischöfe und Klöster vergeben, wodurch sich die Abhängigkeit der Bauern verschärfte. Der Landesausbau der Niederlausitz im 12. und 13. Jahrhundert wurde vor allem durch sorbische Bauern und vereinzelt deutsche Siedler vorangetrieben. Ab dem 16. Jahrhundert nahmen die Belastungen der Bauern zu, als der Adel seine Ländereien erweiterte.
Die Niederlausitz blieb stark von slawischen Wurzeln geprägt, da die meisten Einwohner sesshaft blieben, während nur wenige deutsche Kolonisten einwanderten.
Der Lausitzer Landtag wurde die wichtigste politische Institution, und im 16. Jahrhundert setzten sich die Reformation und die Auflösung der Klöster durch. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde die Niederlausitz im Prager Frieden 1635 an den Kurfürsten von Sachsen übertragen, der nun auch Markgraf der Niederlausitz wurde.
Ländliche Besitzverhältnisse
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts geriet der Adel in eine wirtschaftliche Krise, bedingt durch sinkende Kaufkraft und steigenden sozialen Druck. Um dem entgegenzuwirken, erweiterten die adeligen Landbesitzer ihre landwirtschaftliche Produktion und vergrößerten ihre Gutswirtschaften, was die Bauern zu höheren Abgaben und Frondiensten zwang. In der Niederlausitz kam es daraufhin zu verzögerten Bauernunruhen.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg nahm die Umstellung von Grundherrschaft auf Gutsherrschaft zu. Bauern wurden in verschiedene Kategorien eingeteilt, abhängig von der Größe ihres Guts, was auch die Höhe ihrer Abgaben und Frondienste bestimmte.
Im 18. Jahrhundert verschwammen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Besitzarten durch den wachsenden wirtschaftlichen Druck. Erst Ende des 18. Jahrhunderts, mit den Preußischen Reformen und der Abschaffung der Erbuntertänigkeit 1819, begannen sich die Verhältnisse zu verändern. Bauern konnten ihr Land in Eigentum überführen, mussten jedoch hohe Abgaben leisten, was besonders Kleinbauern in wirtschaftliche Not brachte. Viele verloren ihren Besitz und arbeiteten als Landarbeiter oder in der Industrie.
Die landwirtschaftliche Entwicklung der Niederlausitz blieb im Vergleich zu anderen Regionen zurück. Trotz der Reformen blieben die Erträge gering, und traditionelle Holzbauten prägten weiterhin die Region, da der Massivbau nur langsam Einzug hielt. Bis heute sind viele historische Holzbauten erhalten geblieben.
Die neuen Preußen
Ende 1813 nahm Preußen den Kreis Cottbus zurück, der zuvor 1807 an Napoleon abgetreten worden war. 1815, nach dem Wiener Kongress, wurden die restlichen Teile der Niederlausitz, die bis dahin zu Sachsen gehörten, ebenfalls Preußen zugesprochen. Das Markgraftum Niederlausitz wurde aufgelöst, und Lübben verlor seine Hauptstadtfunktion. Die Autonomierechte der Stände wurden schrittweise aufgehoben. Zwischen 1812 und 1848 wuchs die Bevölkerung der Niederlausitz um 42 %, wobei ein Großteil der Einwohner auf dem Land lebte. Der sorbische Bevölkerungsteil, der auch nach der Gebietsumgestaltung blieb, erlebte durch die preußische Herrschaft eine stärkere Unterdrückung, insbesondere die Unterdrückung ihrer Sprache. Vor der Umgestaltung lebten 95 % der Sorben in Sachsen, nach 1815 unterstanden 80 % der preußischen Verwaltung. In Preußen machten die Sorben nur 6 % der Bevölkerung aus. Die preußische Politik förderte die Assimilation der Sorben, indem sie den Gebrauch der niedersorbischen Sprache einschränkte, was von der evangelischen Kirche weitgehend toleriert wurde. Mitte des 19. Jahrhunderts begann der Abbau von Braunkohle.
Die Niederlausitz als Landschaftsbegriff
Ab 1816 begann die Neuorganisation der Territorialverwaltung in der Niederlausitz mit der Einführung von sieben Landkreisen: Cottbus, Sorau, Spremberg, Calau, Luckau, Lübben und Guben. Diese administrative Gliederung blieb bis 1945 weitgehend bestehen.
Während der nationalsozialistischen Herrschaft wurden viele geographische und regionale Begriffe, auch in der Niederlausitz, umbenannt und an parteipolitische Gliederungen angepasst, was zu Verwirrung führte und historische Unterscheidungen verwässerte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Potsdamer Abkommen kam der östlich der Neiße gelegene Teil der Niederlausitz unter polnische Verwaltung. Die Grenze wurde mit dem „2+4 Vertrag“ von 1990 und einem Vertrag zwischen Deutschland und Polen endgültig festgelegt.
Mit der Gründung des Bezirks Cottbus im Jahr 1952 entstand erstmals seit 1815 wieder ein politisches Territorium, das überwiegend aus dem historischen Kerngebiet der Niederlausitz bestand. Der Bezirk wurde bewusst als „Energiebezirk“ geschaffen und war vor allem durch den Braunkohlenabbau und die Stromerzeugung geprägt. Neben der Energieindustrie entwickelte sich auch die Textilproduktion, insbesondere durch das VEB Chemiefaserwerk in Guben. Ein weiteres Merkmal des Bezirks war die starke Militarisierung der DDR-Gesellschaft, die sich in zahlreichen Militärstandorten widerspiegelte.
Seit 1990 gehört die Niederlausitz zum Bundesland Brandenburg. Die Kreisreform von 1993 berücksichtigte die historische Landschaft der Niederlausitz nur eingeschränkt und orientierte die neue Kreiseinteilung vorrangig an der Nähe zum wirtschaftlichen Zentrum Berlin. In den folgenden Jahrzehnten sah sich die Region mit tiefgreifenden Veränderungen konfrontiert, darunter die Konkurrenz auf dem Weltmarkt, Abwanderung, die Entmilitarisierung, die Umstrukturierung des Braunkohlenbergbaus und in jüngerer Zeit eine gezielte Dekarbonisierungspolitik. Diese Entwicklungen führten zu einem anhaltenden und umfassenden Strukturwandel in der Niederlausitz.
Besiedlung Oberlausitz
Nach den Erkenntnissen der ur- und frühgeschichtlichen Forschung war die Oberlausitz bis in die jüngere Bronzezeit (11. bis 9. Jahrhundert v. Chr.) offenbar nur schwach besiedelt. Die Bevölkerung der Lausitzer Kultur zog später aus dem Neißetal und Böhmen in die Region. Als diese erste bedeutende Siedlungsphase zu Ende ging, dürfte die Bevölkerung über mehrere Jahrhunderte hinweg nur in geringem Maße vorhanden gewesen sein. Erst im 6. und 7. Jahrhundert wanderten slawische Stämme aus dem Osten ein. Der Milzener-Stamm ließ sich im Gebiet zwischen den heutigen Städten Kamenz und Löbau nieder, und ihre Hauptsiedlung lag an der Stelle der heutigen Ortenburg in Bautzen.

Ortenburg in Bautzen als Stadtzentrum
© Heiko Zahn / Adobe Stock
Ostexpansion und territoriale Konsolidierung
Ab dem 10. Jahrhundert gerieten die slawischen Stämme in der Oberlausitz zunehmend unter den Expansionsdruck des ostfränkisch-deutschen Reiches, das unter König Heinrich I. stand. 939 besiegte König Otto I. die Milzener erneut, und um 990 konnte Markgraf Ekkehard I. von Meißen sie endgültig unterwerfen. Mit der territorialen Eroberung und Missionierung wurde die Oberlausitz dem 968 gegründeten Bistum Meißen zugeordnet. Zwischen 1002 und 1031 geriet die Region zeitweise unter den Einfluss des erstarkten polnischen Königreichs.
Das Reichslehen der Oberlausitz wurde über mehrere Jahrhunderte hinweg an verschiedene Markgrafen, Könige und Kaiser vergeben, was verhinderte, dass die Region in das Stammland der jeweiligen Herrscher eingegliedert wurde. Dadurch entwickelte sich der oberlausitzer Adel vor allem aus westlich der Elbe eingewanderten Lehensleuten. Das Markgraftum Oberlausitz besaß daher eine eigenständige Verfassungsgeschichte.
Im 12. Jahrhundert kam die Region endgültig unter die Herrschaft der böhmischen Könige. In dieser Zeit entstanden neben dem älteren Bautzen alle bedeutenden Städte der Oberlausitz, und es wurden wichtige kirchliche Institutionen gegründet. Unter den böhmischen Königen nahm der Landesausbau Fahrt auf, und deutsche Bauern wurden ins Land geholt.
Im 13. Jahrhundert spielte die Einsetzung von Landvögten als Stellvertreter der Landesherren eine wichtige Rolle. Unter den Askaniern (Markgrafen von Brandenburg seit 1157) vereinigte dieses Amt die Befugnisse der Burggrafen und Landrichter und weitete sie aus. Ein bedeutendes Ereignis dieser Zeit war die Teilung der Oberlausitz 1268 durch Markgraf Otto IV. von Brandenburg, die die Region in die Länder Bautzen (Land Budissin) und Görlitz unterteilte, eine Trennung, die bis 1329 Bestand hatte.
Der Sechsstädtebund
Unter der Herrschaft von Karl IV., der seit 1346 deutscher König und König von Böhmen war (und 1355 zum Kaiser gekrönt wurde), entwickelten sich einige Städte der Oberlausitz zu wichtigen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentren der Region. Am 21. August 1346 gründeten die fünf bedeutendsten königlichen Städte der Oberlausitz – Bautzen, Görlitz, Löbau, Kamenz, Lauban sowie das damals noch böhmische Zittau – den Sechsstädtebund.
Diese Gründung erfolgte mit der Zustimmung des böhmischen Königs, der den Städten zahlreiche Privilegien gewährte, um sie im Kampf gegen das Rittertum und Straßenräuberei zu stärken. Der Bund erhielt spezielle juristische Rechte und fungierte stellvertretend für den Landesherren als Träger der Staatlichkeit. Der Landesherr schickte lediglich einen Landvogt als seinen Vertreter in die Oberlausitz, der traditionell aus dem Adel eines der böhmischen Kronländer stammte (bis 1620 wurde nur einmal ein Oberlausitzer als Landvogt eingesetzt).
Nach den Hussitenkriegen ging das Bündnis gestärkt hervor. Bis Ende des 15. Jahrhunderts war das politische System des Markgraftums Oberlausitz weitgehend gefestigt. Neben dem Landvogt gab es in Bautzen und Görlitz jeweils einen Amtshauptmann, und gemeinsam bildeten diese drei Beamten die gesamte königliche Verwaltung. Das politische Zentrum des Landes war der ständische Landtag.
Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts bis zur Teilung der Oberlausitz durch den Wiener Kongress bestand der Landtag aus zwei Ständen: dem „Land“ und den „Städten“. Der Stand „Land“ umfasste die Standesherrschaften, die landsässige Ritterschaft, das Domstift zu Bautzen sowie die Klöster St. Marienstern, St. Marienthal und das Magdalenerinnenkloster Lauban. Der Stand „Städte“ bestand aus den Sechsstädten der Oberlausitz. Aus diesem Grund wurden die Stände ab dem 14. Jahrhundert oft als „Land und Städte“ bezeichnet.
Beide Stände tagten zunächst getrennt: das „Land“ auf speziellen Landtagen und die „Städte“ auf eigenen Städtetagen. Beschlüsse des Landtags konnten jedoch nur gefasst werden, wenn sich beide Stände einig waren, da sie jeweils nur eine Stimme hatten. Diese Regelung blieb bis zur Teilung der Oberlausitz nach dem Wiener Kongress unverändert. Gemeinsam repräsentierten die Stände die politische Einheit des Landes. Bei Streitigkeiten zwischen den Ständen entschied der Landesherr, vertreten durch den Landvogt.
Das höchste Gericht der Oberlausitz war das „Gericht von Land und Städten“, das von beiden Ständen gebildet wurde. Die Entscheidungen dieses Gerichts waren endgültig; ein Einspruch bei den königlichen Gerichten in Prag war nicht möglich.
Im 15. und frühen 16. Jahrhundert gab es Konflikte zwischen Adel und Städten, die sich vor allem um die Obergerichtsbarkeit der Städte in ihrem Einflussbereich sowie die Aufteilung der landesherrlichen Steuerlast drehten.
Versuche des Adels, neben der Ritterschaft auch Prälaten und Herren als eigene Stände einzuführen, scheiterten. Bis zum Wiener Kongress blieb es bei den zwei Ständen mit gleichberechtigter Stimmverteilung.
Herausbildung des Namens (Ober-)Lausitz
Die Region zwischen den Flüssen Pulsnitz im Westen und Queis im Osten, das historische Land der Milzener, hatte bis ins 16. Jahrhundert keine einheitliche Bezeichnung. Stattdessen waren Namen wie „das ganze Land Budissin“ oder „die Länder Budissin und Görlitz“ gebräuchlich. Mit der Gründung des Sechsstädtebundes im Jahr 1346 erhielt das Gebiet jedoch eine neue, prägnante Bezeichnung. Neben den königlichen Städten Bautzen, Görlitz, Lauban, Löbau und Kamenz trat auch das zuvor böhmische Zittau dem Bund bei und wurde in das Bautzener Markgraftum integriert. Dies führte zur Entstehung des Namens „Land der Sechsstädte“ oder kurz „Sechsstädte“, auch bekannt als „Hexapolis“ oder „terra hexapolitana“ in der lateinischen Form.
Ab dem 15. Jahrhundert setzte sich zunehmend der Name „Lusatia“ für die heutige Oberlausitz durch. Er wurde 1409 erstmals an der Universität Leipzig für die gesamte Lausitz verwendet. Im Laufe der Jahrzehnte etablierte sich die Unterteilung in „Lusatia superior“ (Oberlausitz) und „Lusatia inferior“ (Niederlausitz). Der Begriff „Lusatia superior“ tauchte offiziell erstmals 1474 in einer Urkunde des ungarischen Hofes auf. Die Bewohner selbst begannen jedoch erst im 16. Jahrhundert, den Namen Oberlausitz allmählich als Ausdruck einer eigenen regionalen Identität zu verwenden.
Habsburgerherrschaft von 1526 bis 1635
Nach dem Tod Ludwigs II. wurde Ferdinand I. 1526 König von Böhmen und damit auch Landesherr der Oberlausitz. Die neue Herrschaft führte zunächst zu wenig Veränderungen, jedoch prägten Konflikte zwischen Adel und Städten das politische Leben. Ferdinand agierte inkonsequent, um Konflikte in Böhmen und die Finanzierung des Türkenkriegs auszugleichen. Die Oberlausitz war ab 1546 in den Schmalkaldischen Krieg involviert, was zu einem Machtverlust der Städte führte („Oberlausitzer Pönfall“).
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts stabilisierten sich die politischen Verhältnisse, während Bildung und Kultur einen Aufschwung erlebten. Protestantismus wurde toleriert, und die Rechte der Stände gestärkt. Jedoch verschärften sich Ende des Jahrhunderts religiöse Konflikte, bedingt durch die Gegenreformation und politischen Machtstreit.
Im 17. Jahrhundert verschlechterten sich die Beziehungen zu den Habsburgern. Die Oberlausitz schloss sich 1618 dem böhmischen Ständeaufstand an, wurde jedoch schnell von Sachsen besetzt, dass die Region 1623 als Pfand erhielt. Dadurch blieb die Oberlausitz vom Verbot des Protestantismus verschont, während viele Glaubensflüchtlinge aus Böhmen dort Schutz suchten, was zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führte.
Sächsische und preußische Oberlausitz (1815 bis 1945)
Die Oberlausitz entwickelte sich kulturell und wissenschaftlich, unter anderem durch die Gründung der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften (1779) und der Naturforschenden Gesellschaft (1811).
Der Wiener Kongress 1815 führte zur Teilung des Königreichs Sachsen, wobei Preußen große Gebiete, darunter die Hälfte der Oberlausitz mit Görlitz, erhielt. Die willkürlich gezogene Grenze zerschnitt eine historisch gewachsene Einheit, trennte das Siedlungsgebiet der Sorben und führte zu einer Neuordnung der Verwaltung in Preußen und Sachsen. In Preußen wurden vier Landkreise gebildet und der Provinz Schlesien zugeordnet, während in Sachsen die rechtliche Sonderstellung der Oberlausitz 1831 mit der Einführung einer modernen Staatsverfassung aufgehoben wurde.
Die Region entwickelte sich nach 1815 wirtschaftlich erfolgreich, vor allem durch Textilherstellung und Industrie. Die Eisenbahnstrecke Dresden–Breslau, gebaut ab 1844, förderte den Handel. Görlitz profitierte besonders von der preußischen Integration durch industrielle Ansiedlungen und gute Verkehrsverbindungen.
Die Sorben litten unter der nationalsozialistischen Herrschaft ab 1933 durch Repressionen, Vereinsverbote und Einschränkungen der kulturellen Ausübung. Pläne zur Deportation wurden wegen des Kriegsverlaufs nicht umgesetzt. Im Zweiten Weltkrieg blieb die Oberlausitz weitgehend von Luftangriffen verschont, wurde jedoch 1945 zum Kampfgebiet. Sorbische Bürger empfanden die Ankunft der Roten Armee oft als Befreiung von Diskriminierung und Zwangsmaßnahmen der Nationalsozialisten.
Neuste Geschichte seit dem zweiten Weltkrieg
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der östliche Teil der Oberlausitz unter polnische Verwaltung, und die deutsche Bevölkerung wurde vertrieben. Im Zuge dieser Umsiedlungen kamen viele Polen in die Region, vor allem aus den an die Sowjetunion gefallenen Gebieten. In den ersten Nachkriegsjahren wurden auch Flüchtlinge aus dem griechischen Bürgerkrieg in Görlitz untergebracht. Die UdSSR hatte zunächst gefordert, die Oberlausitz der Tschechoslowakei zuzuschlagen, gab diese Forderung jedoch bald auf.
In der sowjetischen Besatzungszone wurde die westliche Oberlausitz dem Land Sachsen zugeordnet. Nach der Auflösung der Länder 1952 gehörte sie zum Bezirk Dresden. Die DDR-Verwaltung teilte die Region weiter auf, wobei der Norden mit den Braunkohlegruben dem Bezirk Cottbus zugewiesen wurde.
Seit 1990 gehört der deutsche Teil der Oberlausitz größtenteils zu Sachsen, doch die Teilung von 1815 hat langfristige Auswirkungen. In der Region gibt es bis heute Streitigkeiten über die historische Identität. Ein Teil betont das Erbe der preußisch-schlesischen Zeit, während andere die jahrhundertelange Einheit der Oberlausitz vor der Teilung hervorheben. Die Region wird deshalb auch als Schlesische Lausitz oder Niederschlesische Oberlausitz bezeichnet.
Ein weiteres Beispiel für die geteilte Identität ist die Entscheidung der Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz, sich 2003 mit der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg zu vereinigen, statt mit der Landeskirche Sachsens. Dies spiegelte die historische Verbindung zur preußischen Geschichte wider. Die Neiße bildet seit 1945 die deutsch-polnische Grenze. Blick von Polen auf das heute zweigeteilte Görlitz.

© till beck / Adobe Stock
STÄDTE
Die Lausitz bedeckt eine Fläche von etwa 13.000 km² und hat rund 1,3 Mio. Einwohner, davon etwa 350.000 in Polen.
Hauptorte der Niederlausitz sind
Cottbus (sorbisch Chóśebuz),
Calau (Kalawa),
Eisenhüttenstadt (ehemaliges Fürstenberg bzw. Stalinstadt),
Guben(Gubin),
Forst (Baršć),
das historische Verwaltungszentrum des Markgraftums Niederlausitz Lübben (Spreewald) (Lubin),
Lübbenau/Spreewald(Lubnjow),
Luckau (Łukow),
Finsterwalde (Grabin),
Senftenberg (Zły Komorow)
Spremberg (Grodk) und Vetschau/Spreewald (Wětošow) sowie im polnischen Teil Żary (Sorau; Žarow).
Für die Oberlausitz sind die Sechsstädte
Bautzen (Budyšin) als Verwaltungszentrum,
Görlitz (Zhorjelc; der polnische Teil heißt Zgorzelec) als größte Stadt,
Lubań (Lauban),
Zittau (Žitawa),
Löbau (Lubij) und Kamenz (Kamjenc) bedeutend,
des Weiteren auch Bischofswerda (Biskopicy),
Niesky (Niska),
Hoyerswerda (Wojerecy),
Weißwasser/O.L. (Běła Woda) und
Bad Muskau (Mužakow).
In der Oberlausitz sind auch die im südlichen Teil gelegenen Städte und Dörfer mit ihrem reichen architektonischen Schatz an historischen Umgebindehäusern interessant, u. a. Ebersbach-Neugersdorf, Großschönau, Wehrsdorf, Sohland an der Spree, Taubenheim/Spree und Obercunnersdorf.
WIRTSCHAFT
Internationale Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle in der Lausitzer Wirtschaft, insbesondere in den Bereichen Braunkohletagebau, Energieerzeugung, Stahlindustrie, chemische Industrie, Maschinenbau, Anlagenbau, Fahrzeugbau und Industrieforschung. Besonders hervorzuheben ist die Bedeutung der Lausitz für die Elektroenergieproduktion, die 2018 10 Prozent der gesamten Erzeugerleistung in Deutschland ausmachte.
Trotz dieser Industrien gilt die Lausitz als strukturschwach. Der Direktionsbezirk Dresden, der neben dem Ballungsraum Dresden auch die Oberlausitz umfasst, erreicht im europäischen BIP-Vergleich einen Indexwert von 87,7, wobei der EU-27-Durchschnitt bei 100 liegt. Im Vergleich dazu hat Dresden alleine einen Indexwert von etwa 121. Diese wirtschaftlichen Unterschiede beeinflussen die Förderwürdigkeit Dresdens in der EU-Politik, was wiederum die Förderfähigkeit der südlichen Lausitz erschwert, insbesondere seit der EU-Osterweiterung. Die Westlausitz erstreckt sich teilweise bis nach Dresden. Die Niederlausitz gehört zur weitläufigeren NUTS-Region Brandenburg-Südwest, die auch Potsdam und das Fläming umfasst.
Energietechnik
Die Entwicklung des Energiestandortes Lausitz steht in Verbindung mit Deutschlands drittgrößtem Energieunternehmen, der Firma Vattenfall Europe AG.

Maschinenbau und Metallbearbeitung
In der Lausitz sind in den Bereichen Sondermaschinen- und Werkzeugbau sowie Vorrichtungs-, Anlagen- und Metallbau zahlreiche innovative und leistungsfähige Unternehmen tätig. Sie knüpfen an die Industrietraditionen, wie beispielsweise der Papierschneidetechnik, dem Backofenbau sowie dem Schienenfahrzeug- und Landmaschinenbau, an.
© penofoto.de / Adobe Stock
Chemische Industrie und Kunststofftechnik
Die Chemische Industrie und die Kunststofftechnik sind schon immer industrielle Kerne der Lausitz. Der Chemiestandort Lausitz ist dabei durch die jahrzehntelangen Traditionen an den Standorten Schwarzheide und Guben geprägt. Seine Entwicklung steht in Verbindung mit den Chemiekonzernen BASF und Trevira. Die Lausitzer Kunststofftechnik hat sich unter anderem als Zulieferer für die internationale Automobilbranche und als Anbieter von Systemlösungen profiliert.

© U.J. Alexander / Adobe Stock
Nahrungs- und Genussmittelindustrie - Hier werden die Pefferkuchen gebacken
Die Nahrungs- und Genussmittelindustrie der Lausitz ist durch eine Vielzahl traditioneller Handwerksbetriebe und moderner Industrieunternehmen geprägt, die weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt sind. Zu den traditionellen Erzeugnissen gehören unter anderem die Pulsnitzer Pfefferkuchen, der Lausitzer Fisch und das Lausitzer Leinöl. Viele Produkte, wie Bautzener Senf, Spreewaldgurken, Wilthener Weinbrand, Neukircher Zwieback, Mineralwasser aus Bad Liebenwerda und der Oppacher Mineralquellen, die Lausitzer Fruchtsäfte, Fleisch- und Wurstwaren aus Weißwasser und Löbau oder die vielfältigen Brauereiprodukte werden bereits deutschlandweit gehandelt und in das Ausland exportiert.
Die Glasindustrie - ein Industriezweig mit großer Tradition
Die Glasindustrie der Region war mitbestimmend für deren wirtschaftliche Entwicklung über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrhundert. In den zwanziger und dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts war die Glasindustrie dieser Region weltweit dominierend. Zu Zeiten der DDR kam von hier nahezu die gesamte Produktion an Wirtschafts-, Blei- und Beleuchtungsglas des Landes. Heute sind nahezu alle am Markt vertretenen Unternehmen der Glasbranche sowie Unternehmen aus dem Zulieferer- und Dienstleistungssektor im Lausitzer Glasring e.V. organisiert. Dessen 28 Mitglieder repräsentieren insgesamt 1.600 Beschäftigte.
Textilindustrie
Die Textilindustrie hat in der Region eine lange Tradition und gehörte neben dem Braunkohleabbau zu den wichtigsten Wirtschaftsbranchen. In der Lausitz liefen die Fäden der europäischen Textilindustrie zusammen, denn sie lag inmitten der Euro-Textil-Region, welche die traditionellen Kerngebiete der Textil- und Bekleidungsindustrie in den deutschen Bundesländern Brandenburg und Sachsen sowie in Polen und in Tschechien umfasste. Nach 1990 schrumpfte die Textilindustrie drastisch bis zum Stillstand. Heute nach über 30 Jahren sind noch einige Fabrikgebäude vorhanden, die in den meisten Fällen ohne Nutzung verfallen und für Touristen als „Lost Place“ Attraktion dienen.
NATURRÄUME
Landschaften bzw. Naturräume der Lausitz sind der Spreewald, Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, Oberlausitzer Bergland, Westlausitzer Hügel- und Bergland einschließlich Dresdner Heide, Sächsisch-Böhmisches Kreidesandsteingebiet (Elbsandsteingebirge) mit dem dazugehörigen Zittauer Gebirge. Auf tschechischer Seite schließt sich das Lausitzer Gebirge an. Seit Beginn der 1990er Jahre entsteht durch die Rekultivierung des Lausitzer Braunkohlerevieres das Lausitzer Seenland als Bergbaufolgelandschaft. Ausgewiesene Naturparks sind der Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft, der Naturpark Niederlausitzer Landrücken und das Zittauer Gebirge.
Die Lausitz gliedert sich in zwei unterschiedliche Landschaftsräume: die Oberlausitz und die Niederlausitz, die jeweils eine eigene geologische Entwicklungsgeschichte haben. Die Niederlausitz wurde während der Eiszeit im Pleistozän (vor ca. 150.000 Jahren) geformt und weist eine vielfältige Landschaftsstruktur auf, die durch Gletscher und deren Rückzug geprägt wurde. Zu den geologischen Merkmalen gehören fruchtbare Grundmoränen, hügelige Endmoränen, Sandflächen und zahlreiche Seen. Der Lausitzer Grenzwall, eine markante Endmoräne aus der Saaleeiszeit, bildet eine wichtige Landschaftsgrenze und erreicht Höhen von bis zu 167 Metern. Dieser Landrücken fungiert als Wasserscheide für Flüsse wie Dahme, Spree und Neiße. Das Urstromtal der Schwarzen Elster und das Baruther Urstromtal, das von der Spree durchzogen wird, gehören ebenfalls zur jüngeren glazialen Landschaft. Besonders hervorzuheben ist der Spreewald, der in diesem Bereich entsteht. Der Muskauer Faltenbogen ist eine weitere geologische Besonderheit, eine Stauchendmoräne, die Sand- und Braunkohleschichten zu einem hügeligen Rücken aufschob. Aktuell prägt die Rekultivierung des Lausitzer Braunkohlereviers das Landschaftsbild, das mit dem Lausitzer Seenland eine neue Dimension erhält.
Die Lausitz gliedert sich in zwei unterschiedliche Landschaftsräume: die Oberlausitz und die Niederlausitz, die jeweils eine eigene geologische Entwicklungsgeschichte haben. Die Niederlausitz wurde während der Eiszeit im Pleistozän (vor ca. 150.000 Jahren) geformt und weist eine vielfältige Landschaftsstruktur auf, die durch Gletscher und deren Rückzug geprägt wurde. Zu den geologischen Merkmalen gehören fruchtbare Grundmoränen, hügelige Endmoränen, Sandflächen und zahlreiche Seen. Der Lausitzer Grenzwall, eine markante Endmoräne aus der Saaleeiszeit, bildet eine wichtige Landschaftsgrenze und erreicht Höhen von bis zu 167 Metern. Dieser Landrücken fungiert als Wasserscheide für Flüsse wie Dahme, Spree und Neiße. Das Urstromtal der Schwarzen Elster und das Baruther Urstromtal, das von der Spree durchzogen wird, gehören ebenfalls zur jüngeren glazialen Landschaft. Besonders hervorzuheben ist der Spreewald, der in diesem Bereich entsteht. Der Muskauer Faltenbogen ist eine weitere geologische Besonderheit, eine Stauchendmoräne, die Sand- und Braunkohleschichten zu einem hügeligen Rücken aufschob. Aktuell prägt die Rekultivierung des Lausitzer Braunkohlereviers das Landschaftsbild, das mit dem Lausitzer Seenland eine neue Dimension erhält.
Die Oberlausitz präsentiert sich landschaftlich völlig anders als die Niederlausitz. Sie wird geomorphologisch vom einheitlichen Lausitzer Granitmassiv geprägt. Hier befinden sich das Lausitzer Bergland und das Zittauer Gebirge, die zum deutschen Mittelgebirge zählen. Die höchste Erhebung ist die Lausche, mit 793 Metern über dem Meeresspiegel. Diese Mittelgebirge gehen auf das Variskische Gebirge aus dem Erdaltertum zurück, das sich in einem großen Bogen vom französischen Zentralplateau bis zur Mährischen Pforte erstreckte. Während der Tertiärzeit, die vor etwa 60 Millionen Jahren begann, zerbrach dieses bereits stark erodierte Gebirge durch die Auffaltung der Alpen in einzelne Schollen, die abgeschliffene, gerundete Formen erhielten. Das Oberlausitzer Gefilde, ein offenes, welliges Hügelland zwischen Kamenz und Löbau mit Bautzen als Zentrum, ist von Natur aus landwirtschaftlich ertragreich. Diese Region war historisch ein Zentrum der Lausitzer Kultur und deutlich früher und intensiver besiedelt als die umliegenden Landschaftsräume. Nur der Norden und Nordosten der Oberlausitz zeigt Spuren der Eiszeit. Dort liegt die flache Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Die größeren Flüsse der Oberlausitz verlaufen alle von Süden nach Norden. Im Westen markierte die Pulsnitz einst die Grenze zu Sachsen. Die Spree entspringt im Süden und fließt durch Bautzen, während die Lausitzer Neiße im böhmischen Isergebirge ihren Ursprung hat. Sie tritt bei Zittau in die Oberlausitz ein, durchfließt Görlitz und verlässt das Gebiet bei Bad Muskau in Richtung Niederlausitz.
QUELLEN
https://de.wikipedia.org/wiki/Lausitz
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/304328/region-im-wandel/
https://www.lausitzer-museenland.de/service/geschichte-der-lausitz/#die_lausitzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Niederlausitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberlausitz
https://www.verlassenes.de/textilfabriken
https://lausitz.de/de/wirtschaft/standort-mit-profil.html
https://www.geschichtsverein-rak.de/rak-Grenzsteine.htm
© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.