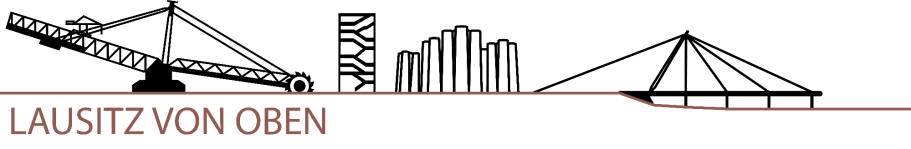BLAUES WUNDER

Zwischen Hörlitz und dem Lausitzring, inmitten von Wäldern und verwilderten Feldern, steht ein Schaufelradbagger, im Volksmund auch als Blaues Wunder bezeichnet.
Mit seinen gigantischen Ausmaßen wirkt er wie ein Relikt von einem anderen Planeten – beeindruckend, still und erhaben in der Landschaft, fernab der Größen, die wir aus unserem Alltag kennen.
EINE REISE IN DIE VERGANGENHEIT - DIE GESCHICHTE DES BAGGERS

Zwischen 1964 und 1965 wurde der Schaufelradbagger vom VEB Schwermaschinenbau Lauchhammerwerk gebaut und daraufhin im Tagebau Meuro zum Kohleabbau eingesetzt. Der wirtschaftliche Umbruch nach der Wiedervereinigung 1990 sorgte für steigenden Druck durch Umweltschutzanforderungen und deutete den langfristigen Plan des Kohleausstieges an. Daher wurde 1999 der Tagebau Meuro als letzter Tagebau der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) stillgelegt.
Im Rahmen der Rekultivierung des Tagebaus blieb der Schaufelradbagger bis 2002 im Einsatz, um die ehemaligen Abbauflächen für eine neue Nutzung vorzubereiten. Durch die Flutung des Tagebaus entstand der Großräschener See, während weitere Flächen für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Naturschutz gezielt aufbereitet wurden.
Der eigentliche Plan den Bagger daraufhin zu verschrotten, wurde durch die Gemeinden Schipkau, Senftenberg und Großräschen verhindert. Er steht symbolisch für die jahrzehntelange Kohleindustrie in der Region und ist daher für die Gemeinden ein bedeutendes Wahrzeichen und Identitätsträger.
So konnte der Bagger 2003, mit einer Standfrist von 15 Jahren, an den Südwestrand des ehemaligen Tagebaus bei Hörlitz umgesetzt werden, wo er noch bis heute steht. Dort hebt ihn seine blaue Farbe hervor und sorgt dafür, dass sich im Volksmund die Bezeichnung „Blaues Wunder“ etabliert hat.
Nachdem sich 2019 Bürger*innen erfolgreich gegen den Abriss einsetzten, ist dieser nun wieder ein aktuelles Thema. Im August 2024 setzten sich die Bürgermeister von Großräschen, Schipkau und Senftenberg für die Entfernung des Blauen Wunders von der Landesdenkmalliste aufgrund von Verfall und Vandalismus ein. Wie es nun weiter geht, bleibt offen.
Schaufelradbagger im Einsatz (© LMBV/Radke)
TECHNISCHE DATEN – EIN KOLOSS AUS STAHL
Steht man vor dem Schaufelradbagger, wird man nahezu erschlagen von seiner Größe. 50m hoch und 171,5m lang ist die Maschine. Ungewohnt große Maße, die sein Gewicht von 3850 Tonnen rechtfertigen. Das Schaufelrad besitzt 10 Schaufeln, die jeweils 1,5 Kubikmeter Kohle fassen können. So erreichte der Bagger eine Abbauleistung von 5130 Kubikmeter pro Stunde. Das entspricht in etwa einem Würfel mit einer Kantenlänge von 17 Metern.
Diese Zahlen stehen für die Leistung, die der Schaufelradbagger erbracht hat, wodurch der Kohleabbau in diesen Größenverhältnissen möglich war.

DENKMALBEWAHRUNG ODER STRUKTURWANDEL – EIN INTERESSENKONFLIKT
Bleibt das Blaue Wunder nun stehen oder nicht? Das ist wohl eine Frage, die viele Bewohner der Region beschäftigt.
Jahrzehntelang war die Region von der Braunkohle geprägt, und zahlreiche Menschen fanden in dieser Industrie ihre Arbeit – eine Leistung, auf die viele bis heute mit Stolz zurückblicken. Das Blaue Wunder repräsentiert einen Teil dieser jahrzehntelangen Identität.
Gerade weil der Koloss an einer solch ruhigen und idyllischen Stelle steht, wirkt er so atemberaubend und beeindruckend auf die Menschen. Seien es die Einwohner, die dadurch an die Zeit des Kohleabbaus erinnert werden, oder Touristen, die dadurch auf diese Vergangenheit aufmerksam gemacht werden.
Sozialgeschichtlich und kulturell ist das Blaue Wunder daher enorm wichtig. Im Internet sind viele Artikel zu finden, in denen es heißt, man solle dieses erhaltenswerte Gut gebührend pflegen. Doch eine solche Instandhaltung kostet mehrere Millionen Euro. Daher stellt sich die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, das Geld in die Bewahrung des Blauen Wunders zu investieren. In der Region gibt es zum einen bereits Maschinen, die an die Zeit des Braunkohleabbaus erinnern, zum anderen ist die Lausitz eine strukturschwache Region. Sie besitzt einen BIP unter dem europäischen Durchschnitt und kämpft mit hoher Arbeitslosigkeit, geringer Wertschöpfung und starke Abwanderung junger, gut qualifizierter Menschen.
Daher stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, in eine ausgebaute Infrastruktur, mehr Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote und Schaffung neuer Arbeitsplätze zu investieren. Hier trifft der Wunsch die regionale Identität zu bewahren auf die Notwendigkeit, den Blick nach vorn zu richten und eine zukunftsfähige Struktur aufzubauen.
STANDORT
© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.